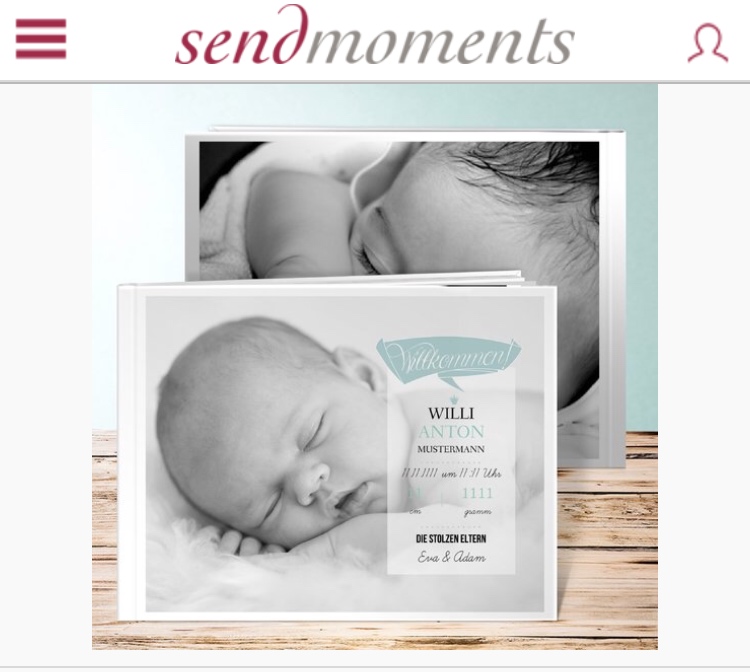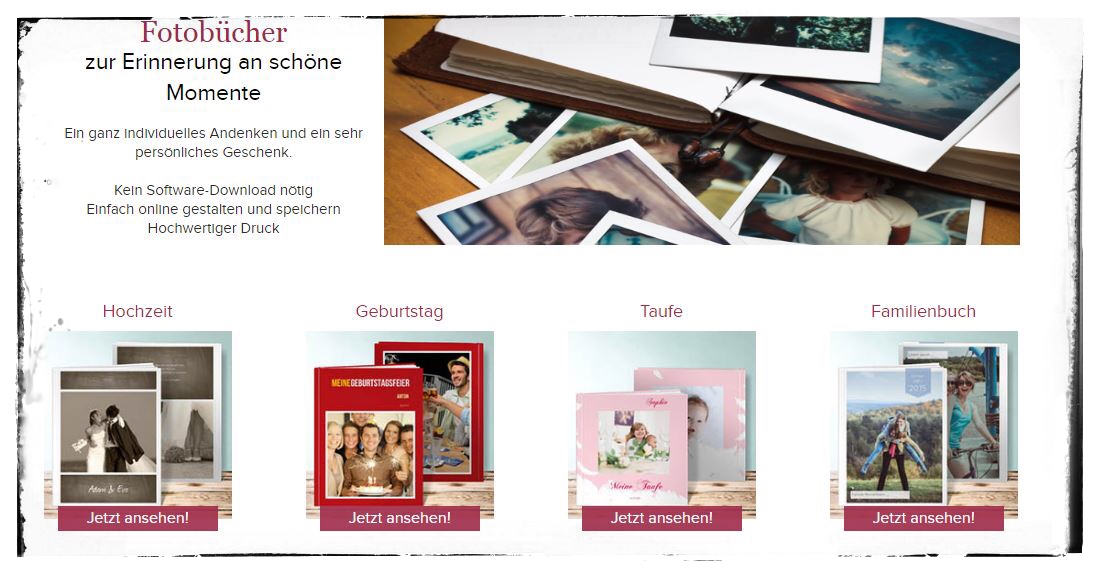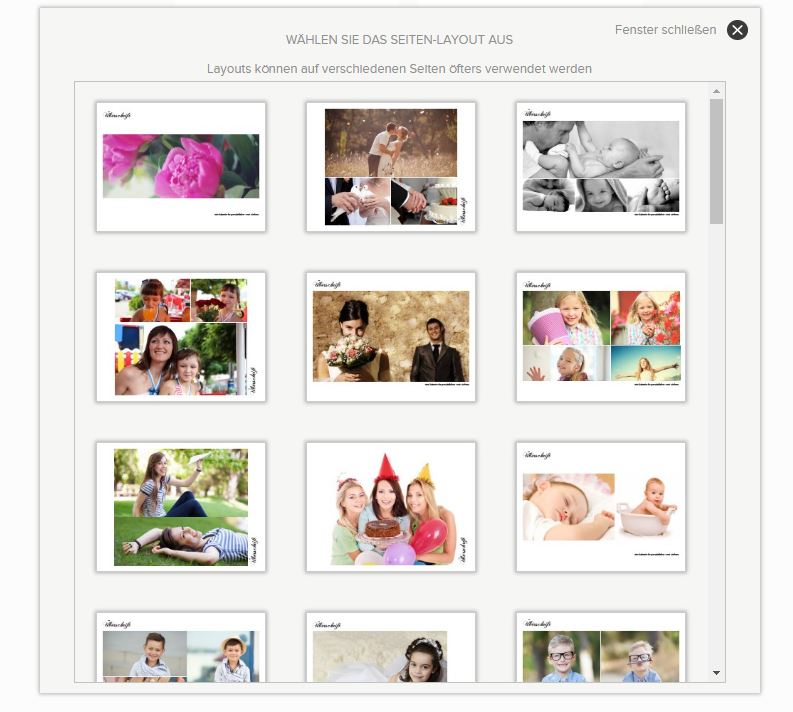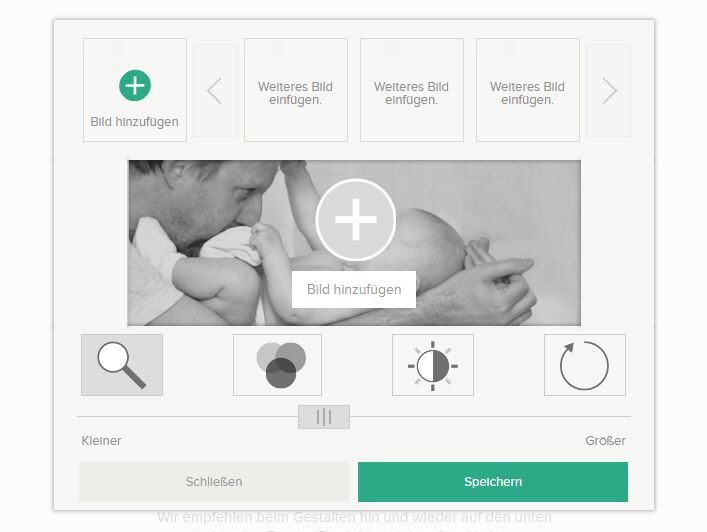In letzter Zeit muss ich immer häufiger an den Moment denken, der mit der schrecklichste in meinem Leben war. Und deshalb schreibe ich jetzt diesen Text. Vielleicht hilft es auch anderen, wenn sie das hier lesen, weil unsere Geschichte gut ausgeht. Als unser Sohn Levi acht Wochen alt war, schickte uns die Kinderärztin zum Kardiologen. Es war der erste Besuch beim Kinderarzt überhaupt, alles war neu, aufregend, die Geburt noch so frisch. Sie hatte ein Herzgeräusch gehört. Zu 99 Prozent sei es nichts, beruhigte sie mich. Wir gehörten in diesem Fall leider nicht dazu.
Ich ging allein mit Levi zum Arzt. 99 Prozent sind ganz schön viel. Endlos lange wischte der Kardiologe mit seinem Ultraschallgerät auf dem winzigen Brustkorb herum. Meinem Sohn gefiel das gar nicht. Er weinte, ich konnte ihn nicht beruhigen, wurde zunehmend nervöser. Irgendwann stellte ich die entscheidende Frage: „Ist alles okay?“ Natürlich war es das nicht. Die Antwort klang metallisch und weit, weit weg. Es waberten nur noch zwei Wörter unkontrolliert durch meinen Kopf: Loch und Operation. Mein Mann kam, der Arzt erklärte uns alles. Aber die Wörter waberten immer noch. Ich bekam nichts mit. Das kleine schluchzende Wesen in meinem Arm hatte einen Herzfehler. Einen Ventrikel-Septum-Defekt, sprich, ein Loch zwischen den Herzkammern. Ein VSD ist einer der häufigsten angeborenen Herzfehler, das war die gute Nachricht. Mich beruhigte sie in diesem Moment nicht. Ich rief meine Mutter an, meine beste Freundin. Die wiederum informierten die anderen. Alle weinten. Bei dem Gedanken an die OP verkrampfte sich mein Herz, mein ganzer Körper.
„Ja, doof mit dem Herzfehler, aber hey, wir haben doch so ein Glück“
Vor der Geburt hätte ich einfach stundenlang geheult und wäre dann irgendwann erschöpft eingeschlafen. Das ging jetzt nicht. Es musste weitergehen, Levi durfte nicht merken, dass hier gerade ordentlich etwas schief lief. Er brauchte starke Eltern, einen ganz normalen Alltag. Wenn das Baby kräftig genug ist, erfolgt so eine Operation nicht direkt nach der Diagnose, sondern etwa mit einem halben Jahr. Für die Chirurgen ist es einfacher, wenn das Herz des Kindes etwas größer ist, für das Kind ist es einfacher, wenn es schon etwas an Gewicht zugelegt hat. Und wir hatten Glück: Levi entwickelte sich normal. Er war zwar ein Leichtgewicht, aber er nahm zu und wuchs. Bei der Größe des Lochs war das keine Selbstverständlichkeit. Das erzählte ich dann auch immer fleißig herum. Ja, doof mit dem Herzfehler, aber hey, wir haben doch so ein Glück. Stimmte auch, aber in mir drin schrie jemand, und dieser jemand war nicht sonderlich feinfühlig. Er brüllte laut und lief dabei polternd durch meinen Körper: „Levi wird operiert, sie schneiden ihm den Brustkorb auf, sie legen sein Herz still – vielleicht für immer.“ Ich mochte diesen jemand nicht sonderlich, aber er hatte doch recht, oder? Bei so einer großen Operation kann ungefähr alles einfach nur schiefgehen. Schließlich sprach ich Tacheles mit jemand. Ich wollte meine Ruhe, ich wollte einfach eine schöne Zeit mit meinem Sohn. Und die machten wir uns auch. Jemand hielt sich meist im Hintergrund, flüsterte nur noch leise seine Parolen.
Termin in der Herzklinik
Etwa alle zwei Wochen mussten wir zum Kardiologen. Das Ergebnis war immer dasselbe: Loch noch da, wird nicht zuwachsen. Ab und an kommt es nämlich vor, dass so ein Defekt nicht relevant ist oder auch wieder verschwindet. Allerdings sind die Löcher in solchen Fällen dann kleiner oder liegen im Muskel-, nicht im Bindegewebe wie bei Levi. Trotzdem war da immer noch dieser Funke Hoffnung in mir, der sich den Platz mit jemand teilte. Ich drängte auf einen Termin in der Herzklinik. Vielleicht war unser Arzt ja auch ein Dilettant. War er aber nicht. Meine Hoffnungen zerschlugen sich von Woche zu Woche mehr, und jemand wurde wieder lauter.Dann wurde der OP-Termin festgelegt, und jemand brüllte wie am Spieß. Die zwei Wochen vor der Operation waren die schlimmsten. Der Kleine schlief in seinem Beistellbettchen direkt neben unserem Bett. Oft lag ich wach und starrte ihn einfach nur an. Manchmal hielt ich es nicht mehr aus, ging auf den Balkon, schaute mir den Sonnenaufgang an, atmete tief durch, manchmal weinte ich. Vielleicht klingt es seltsam, dass ich nur manchmal weinte, aber ich wollte einfach, dass Levi die beste Zeit überhaupt hat und nicht ständig in das verheulte, traurige Gesicht seiner Mama gucken musste.
Schließlich wurde Levi mit fünf Monaten operiert. Die Warterei hatte ein Ende, und jemand würde sich bald von mir verabschieden – hoffentlich für immer. Aber zunächst wurde er lauter denn je. Wir reisten einen Tag vor der Operation an. Levi bekam einen Zugang in den Kopf, die Standarduntersuchungen wie EKG und Ultraschall folgten, er wurde geröntgt, von oben bis unten durchgecheckt. Uns tat alles einfach nur weh. Und dann immer wieder dieser Satz: „Seien Sie froh, dass er noch so klein ist, er wird sich an nichts erinnern.“ Natürlich wusste er nicht, was ihm blühte, aber ganz sicher wusste er, dass er den Zugang in seinem Kopf doof findet, dass lauter fremde Menschen an ihm herumfummeln und wir einfach nur zugucken. Wir durften in dieser Nacht zu dritt in einem Zimmer schlafen und bei ihm sein. Kurz vorm Schlafengehen alberten wir herum, und er lachte, bis er nach Luft schnappen musste. Der Schmerz in mir drin wurde immer größer. Mein Mann und ich wechselten verzweifelte Blicke.
Morgens wurden wir früh geweckt, Levi bekam ein erstes Medikament, das ihn beruhigte. Ab diesem Zeitpunkt bekam er nichts mehr mit. Wir durften ihn bis zum Fahrstuhl begleiten, dann mussten wir uns verabschieden. Sie schoben sein Bett in den Aufzug, die Türen schlossen sich und wir blieben allein mit jemand auf der Kinderstation zurück. Mein Mann weinte. Es war ein scheußliches Gefühl, das eigene Baby in fremde Hände zu geben und nicht genau zu wissen, ob wir Levi wiedersehen würden.
Eine Schwester war für uns zuständig, sie erklärte und zeigte uns alles, was es zu wissen gab. Die Intensivstation im Souterrain, den Platz, an dem sein Bettchen stehen würde. Wir versuchten, zu frühstücken, sammelten unsere Sachen ein, ich pumpte Milch ab. Wir gingen spazieren, in die Cafeteria, schließlich saßen wir eine Stunde zu früh im Elternzimmer der Intensivstation. Dort gab es eine Kaffeemaschine, eine Milchpumpe, einen Tisch, ein Sofa, einen Fernseher. Die Uhr an der Wand tickte, aber lief sie auch weiter? Es kam mir nicht so vor. Schließlich waren die geplanten sechs Stunden vorbei, aber die Tür blieb geschlossen, und das Telefon klingelte nicht.
Am Tisch saß eine alte Frau, sie weinte. Ihr neugeborener Enkel lag auf der Intensivstation, sie schaffte es nicht hinein. Zu groß war ihre Angst, dass sie den Anblick nicht aushalten könnte. Sie wolle für ihren Sohn da sein, sagte sie. Die Milchpumpe war hinter einem Paravent versteckt. Keine schöne Atmosphäre zum Abpumpen, aber das war nicht wichtig. Nichts war mehr wichtig in diesem Moment.
Gute Nachrichten
Die Tür öffnete sich, nachdem eine weitere Stunde vergangen war. Die Chirurgin zog ihren Mundschutz herunter, machte ein ernstes Gesicht. Ich dachte, das war’s, es ist etwas schief gelaufen. Dann sagte sie: „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben’s hingekriegt. Das Loch war größer als gedacht und lag ungünstig an der Aorta. Wir mussten einen riesigen Patch einnähen.“ Für mich zählte in diesem einen Augenblick nur, dass Levi lebte. Wir würden ihn gleich wiedersehen, sein Bettchen würde an dem uns gezeigten Platz stehen. Die Tränen liefen mir die Wangen hinunter. Eine halbe Stunde später durften wir zu ihm. Levi lag in diesem großen Bett mit den orangefarbenen Gitterstäben. Er sah so verloren aus, so klein. Schläuche, Drähte, weitere Zugänge und ein großer Verband verdeckten seinen nackten Körper. Ich hatte erwartet, spätestens jetzt zusammenzu- brechen oder zumindest irgendwie auszuflippen, aber ich war einfach nur glücklich. Glücklich, dass unser kleiner Sohn dort lag und diese Operation überstanden hatte, dass sein Herz wieder schlug. Sehe ich mir heute, vier Monate später, diese Bilder an, weine ich manchmal. Aber damals war ich einfach nur glücklich.
Levi lag mit drei anderen Babys auf einem Zimmer, hinter ihm waren zwei Monitore aufgebaut und drei Ständer mit Spritzenpumpen sorgten ständig dafür, dass 17 Medikamente seinen Kreislauf stabil hielten. Es piepte immer irgendwo. Herzschlag zu schnell oder zu langsam, Temperatur zu hoch oder zu niedrig, Atmung selbstständig oder nicht. In den ersten 24 Stunden lag Levi noch im künstlichen Koma. Er wurde beatmet, Herz und Lunge sollten sich an ihre normale Funktion gewöhnen. Ständig liefen andere Eltern an unserem Zimmer vorbei. Auch die Eltern des Babys, dessen Oma den ganzen Tag im Elternzimmer saß und betete. Kurze starre Blicke wurden ausgetauscht. Es stand nicht gut um ihr Kind.
Der alte fröhliche Levi
Auf der Intensivstation gibt es Besuchszeiten. Wir blieben, solange wir durften, hielten jeder eine Hand, sangen und lasen Levi etwas vor, dann fuhren wir nach Hause. Im Hausflur fehlte der Kinderwagen, die Wohnung wirkte seltsam fremd. Wir riefen noch zweimal nachts an, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. So ging es die nächsten sechs Tage. Levi wurde wach, es wurden jeden Tag weniger Schläuche, weniger Zugänge. Irgendwann durften wir ihn selbst füttern, wickeln, endlich wieder halten, endlich wieder im Arm spüren. Dann schenkte er uns das erste Lächeln nach Tagen. Er wurde langsam der alte fröhliche Levi. So ergeht es dort nicht jedem. Im Elternzimmer sprach mich eine junge Mutter an. Sie sprach kaum Deutsch, kein Englisch. Zusammen mit ihrem Mann war sie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Ihre Tochter kam hier zur Welt – zum Glück. Sie verstand nicht, was mit ihrem Baby los war, die Kleine lag zusammen mit Levi auf dem Zimmer. Beide hatten einen VSD ähnlicher Größe, Levi war wach, ihre Kleine nicht. Aber VSD ist nicht gleich VSD, viele Faktoren spielen eine Rolle, wie lange ein Kind braucht, um sich zu erholen. Ich versuchte ihr das zu erklären, sie war so verzweifelt, so traurig. Ich bin nicht sicher, ob sie mich verstanden hatte. Wir gaben einer Ärztin einen Hinweis, und sie machte dem Paar neuen Mut. Als wir Levi zum ersten Mal in einen Kinderwagen des Krankenhauses legten und mit ihm das Zimmer verließen, um einmal über den Flur zu fahren, schauten die Eltern der Kleinen zu uns hinüber, sie lächelten verhalten. Wer schon einmal auf einer Intensivstation war, kann die Stimmung vielleicht nachvollziehen. Dort geht es um Leben und Tod, ein Ort, an dem niemand sein möchte, aber noch weniger möchte man, dass sein eigenes Kind dort sein muss. Viele der kleinen Patienten dürfen nicht nach wenigen Tagen wieder nach Hause wie Levi, einige wenige verlassen die Intensivstation nie wieder.
Der Enkel der Frau hat nicht überlebt. Das weiß ich, weil ich gerade Milch abpumpte, als die Nachricht das Elternzimmer flutete. Nach kurzer Zeit trafen immer weitere Familienmitglieder ein. Sie alle gingen nacheinander auf die Station, um Abschied zu nehmen, um gemeinsam zu weinen. Mir wurde übel. Wir hatten Glück, diese Familie nicht. Und darum geht es doch letztlich im Leben: Glück. Nach sechs Tagen kam Levi auf die Kinderstation und nach weiteren vier Tagen durften wir das Krankenhaus verlassen. Auf dem Weg zum Auto trafen wir das Paar aus Afghanistan wieder. Ihrer Kleinen ging es besser, beide lächelten, sie waren zuversichtlich, dankbar.
„Eine ganze Gemeinde hat für uns gebetet“
Die lange Narbe auf Levis Brust verblasst langsam. Meine Erinnerungen nicht. Wie auch, jedes klitzekleine und große Ereignis in seinem Leben ist sauber abgelegt. Die meisten sind in der Schublade mit den schönen Dingen, der Herzfehler ist eben in der mit den weniger schönen – zusammen mit so banalen Dingen wie Blähungen oder dem ersten Schnupfen. Da ich diese Geschichte anonym schreibe, bringt es eigentlich wenig, wenn ich mich noch einmal bei unseren Familien, Freunden, den Ärzten und dem Krankenhauspersonal bedanke, aber vielleicht erkennt uns ja der eine oder andere. Ich war überwältigt von der Anteilnahme und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das alles nicht alleine schaffen mussten. Es ist einfach schön, zu wissen, dass so viele Menschen an uns gedacht, so viele Kerzen für Levi gebrannt haben. Ich bin nicht sonderlich religiös, aber sogar eine ganze Gemeinde hat für uns gebetet. Es musste einfach gut gehen, es gab auch keine andere Option. Und es ist einfach Wahnsinn, was die Ärzte, Schwestern und Pfleger im Krankenhaus leisten. Ich weiß nicht, wie oft wir dieselben Fragen gestellt haben – und Fragen hatten wir viele. Immer bekamen wir eine nette ausführliche Antwort. Wenn wir nachts anriefen, um uns nach Levi zu erkundigen, waren alle voller Verständnis und erzählten uns oft, was für ein freundlicher kleiner Bursche er sei.
Wir müssen jetzt noch regelmäßig zum Kardiologen, aber Levi geht es gut, sein Herz schlägt normal, der Patch ist weitestgehend dicht. Er braucht keine Medikamente und wird voraussichtlich ein ganz normales Leben führen. Jemand ist verschwunden und belästigt mich schon lange nicht mehr. Der Alltag ist da und ich liebe ihn. Ich koche seine Flaschen und Schnuller ab, während Levi neben mir den Fußboden ableckt. Mir wird das Herz schwer, wenn er wegen eines Schnupfens nachts nicht schlafen kann. Ich frage mich, wie es wird, wenn ich bald wieder arbeiten gehen muss und mein Mann dann hier die Zeit mit ihm genießen darf. Jeden Morgen habe ich den Kleinen im Arm, er lächelt mich an und ich werde von der wahnsinnigen Liebe zu ihm überrollt. Und da ist es dann wieder, das alles entscheidende im Leben: pures Glück.
Wenn einer von Euch mehr erfahren möchte, weil er vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt, schreibt Muddi. Sie kann Euch unsere Kontaktdaten geben. Wir helfen gerne weiter, wenn wir können und teilen unsere Erfahrungen mit euch.
*Dieser Gastbeitrag kommt von einer lieben Freundin, die mit ihrer Geschichte anderen Eltern helfen möchte, aber lieber anonym bleibt .
Foto: http://www.unsplash.com/@ileanaskakun
Gefällt mir Wird geladen …